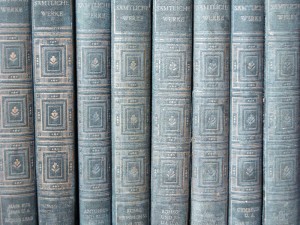 Es sollte nicht leichtfertig mit der Bezeichnung „Klassiker der Weltliteratur“ ungegangen werden, da ja jede Nation dazu seine eigene Meinung hat. Es ist tatsächlich so, dass mit einer klaren Unterteilung zwischen Klassiker der Weltliteratur – und keine Klassiker der Weltliteratur – politische und kulturpolitische Scherben entstehen könnten. Zum Beispiel könnte ein Land überhaupt kein Interesse an deutschen Dichtern haben, welche ihnen als Klassiker der Weltliteratur vorgestellt werden. Die Einwohner dieses Landes könnten in einigen Werken ihrer Autoren Klassiker der Weltliteratur sehen, was wiederum in der Welt kein positives Echo findet.
Es sollte nicht leichtfertig mit der Bezeichnung „Klassiker der Weltliteratur“ ungegangen werden, da ja jede Nation dazu seine eigene Meinung hat. Es ist tatsächlich so, dass mit einer klaren Unterteilung zwischen Klassiker der Weltliteratur – und keine Klassiker der Weltliteratur – politische und kulturpolitische Scherben entstehen könnten. Zum Beispiel könnte ein Land überhaupt kein Interesse an deutschen Dichtern haben, welche ihnen als Klassiker der Weltliteratur vorgestellt werden. Die Einwohner dieses Landes könnten in einigen Werken ihrer Autoren Klassiker der Weltliteratur sehen, was wiederum in der Welt kein positives Echo findet.
Also sollte diplomatisch und feinfühlig mit diesem Thema umgegangen werden.
Wird gründlich recherchiert, dann erfährt der Interessent, dass Christoph Martin Wieland mit seinem „Weltmann“ das erste Mal die „Weltliteratur“ in das Spiel brachte. Aber dazu hatte bereits Goethe im Jahre 1827 eine andere Meinung. „Weltliteratur“ nannte er die Werke, deren Geist über die Grenzen der eigenen Nation hinausging. Es wurde also eine gewisse Weltoffenheit erreicht. So könnten schon Werke der Literatur, welche über Ländergrenzen hinweg großes Interesse gefunden haben, als Klassiker der Weltliteratur bezeichnet werden.
Allerdings sehen auch hier Kritiker noch keinen verbindlichen Beweis dafür, dass es sich tatsächlich um Weltliteratur handelt. Da Religionen, historische Prozesse, politische Situationen in der Welt, sehr unterschiedlich betrachtet werden, ist es kaum möglich, allgemeingültige Kriterien für den Begriff „Weltliteratur“ und deren Klassiker zu finden.
Ohne diese Angelegenheit aber zu überspitzen, kann aber sicher trotzdem weiterhin für über Jahrhunderte hinweg bekannte und beliebte Dichter die Bezeichnung „Klassiker der Weltliteratur“ verwendet werden. Da dürfte weder die Nation noch die Religionszugehörigkeit eine verneinende Aussagekraft besitzen.